Kroniothermen

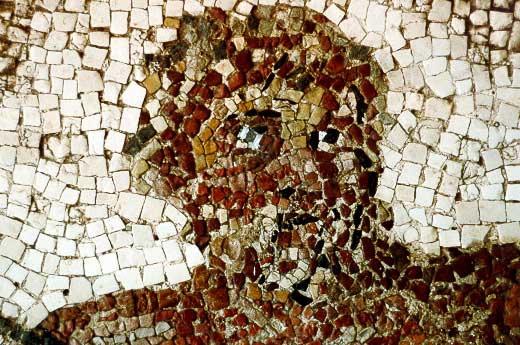



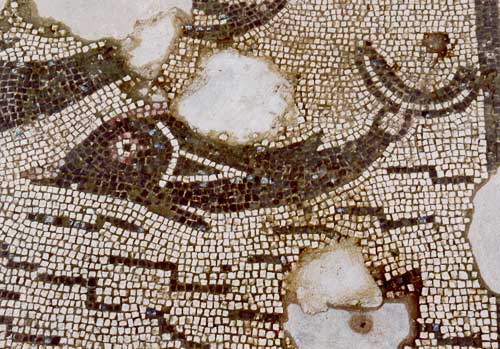
Am Fuße des Kronionhügels, in der Nähe des heutigen Eingangs zum archäologischen Gelände, befinden sich die sog. Kronionthermen - eine komplexe Anlage, die u.a. mit einer Pisina und Baderäumen ausgestattet ist (zur Funktion s.u. Berichte des Ausgrabungsleiters Prof. Ulrich Sinn).
Die Peristylhallen des Schwimmbades schmückt ein geometrisches Muster aus Acht- und Vierecken. Der Rapport wird in der Mitte jeder Portikus durch ein rechteckiges Feld mit figürlicher Darstellung unterbrochen. Das "Emblema" der Westhalle zeigt einen Triton mit vier ihn flankierenden Hippokampen. Das 0.91 x 2.74m große Bild war nach Westen ausgerichtet, wo sich ursprünglich der repräsentative Eingang des Gebäudes befand. Das die Seewesen umgebende Wasser ist auf dem weißen Hintergrund durch wenige graue Linien angedeutet. Bei den Figuren dominieren Braun- und Grautöne. Im Gesicht des Tritons sind die Tessellae ganz ungleichmäßig geschnitten und auf impressionistische Weise aneinandergefügt.
Ungenauigkeiten bei der Wiedergabe der Figuren und des geometrischen Rahmens
lassen darauf schließen, daß der Mosaizist seine Vorlage nicht
richtig verstand bzw. zu schnell und ungenau arbeitete. Die Beine des
weitgehend menschlich gebildeten Tritons gehen ab den Knien in zwei spiralenförmig
eingedrehte Flossen über. Von der rechten Schwanzflosse ist nur der
Ansatz angegeben. An der linken Körperseite ist ihr Verlauf hingegen
nicht klar zu erkennen. Das Mäntelchen ist nicht, wie sonst üblich,
um den Oberarm gewunden, sondern unter die Achsel geklemmt. Die Farbe
der Zügel wechselt willkürlich von Dunkelbraun und Schwarz zu
Hellbraun. In seiner rechten Hand hält der Triton fälschlicherweise
nur von einem Hippokampen die Zügel. Auch im Rahmen lassen sich Unstimmigkeiten
feststellen: in einem rechteckigen Feld wurde ein Kreuz vergessen, die
gestreiften Bänder zwischen den Rechtecken sind unterschiedlich wiedergegeben
und die rote Linie des Mäanders ist einmal unterbrochen.
Im Süden der Thermenanlage fand man ein weiteres Mosaikbild mit einer
Nereide, die in Rückenansicht auf einem Seestier nach links reitet.
Das 1.02 x 2.76m große Feld war nach Süden orientiert, wo sich
allerdings keine Türöffnung befand. Bei der Auffindung war der
Kopf des Tieres noch erhalten, wie eine Schwarzweißaufnahme aus
dem letzten Jahrhundert zeigt. Im Nereidenmosaik dominieren Grün-,
Grau- und Brauntöne. Der Mantel ist durch gelbe Tessellae besonders
hervorgehoben. Der rahmende Hakenkreuzmäander ist etwas schmaler
und kleinteiliger als beim Tritonmosaik und umschließt Quadrate
statt liegender Rechtecke. Unterschiede bestehen auch bezüglich der
Wiedergabe der Figuren. Ganz anders sind beispielsweise die Schwanzflossen
des Seestieres und der Hippokampen gebildet. Bei dem Seestier ist die
Flosse sie mit zahlreichen Zacken versehen, bei den Hippokampen hingegen
einfach zweigeteilt. Die Plastizität ist auf unterschiedliche Weise
zum Ausdruck gebracht, so ist der helle, mittlere Abschnitt bei dem Seestier
abwechselnd hellblau, grün und weiß gestreift, bei den Hippokampen
nur in Grautönen angegeben. Auffallend ist weiterhin, daß die
Nereide mit ihrem Kopf fast an die innere Begrenzung des Rahmens stößt,
während der Triton kaum mehr als die Hälfte der ihm zur Verfügung
stehenden Bildhöhe in Anspruch nimmt.
All diese Unterschiede könnten ein Hinweis darauf
sein, daß hier zwei verschiedene Mosaizisten tätig waren.
Das später entstandene Schwarzweißmosaik mit den Delphinen
ist viel einfacher und gröber gearbeitet als die beiden anderen Mosaikbilder.
Der Rahmen besteht lediglich aus zwei blauen Streifen mit einem breiten,
weißen Band in der Mitte. Nur wenige Details in Rot und Weiß
beleben die dunkelblauen Delphinkörper. Die Wellen sind, anders als
beim Tritonmosaik, durch abgetreppte, blaue Streifen angedeutet.
BCH 113, 1989, 615ff. Abb. 66; BCH 114, 1990, 746 Abb. 56. 57; BCH 112,
1988, 632 Abb.38; ARepLond 1989-90, 30f. Abb. 22; U. Sinn, Meletemata
13. Achaia und Elis in der Antike. Akten des 1. Internationalen Symposiums
Athen, 19.-21. Mai 1989 (1991) 365ff.; Ders., Nikephoros 2, 1989, 273;
Ders., Nikephoros 5, 1992, 75ff.; P. Graef in: Die Baudenkmäler von
Olympia. Olympia II (1892) 181 Abb. 1 Taf. 106. 107; N. Yalouris, ADelt
22,1, 1967, Chron Taf. 148,1; Mallwitz a.O. (Startseite) 109; Ders., AW
19/2, 1988, 41; Hellenkemper Salies a.O. 267 Anm. 153; S. Gozlan, La Maison
du Triomphe de Neptune à Acholla, Botria-Tunisie (1992) 194f.;
Verf., Die kaiserzeitlichen Mosaiken in Olympia. Eine Bestandsaufnahme,
in: VI Coloquio internacional sobre Mosaico antiguo. Palencia-Mérida,
Octubre 1990 (1994) 135-147.
zurück zum Online-Artikel