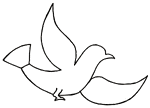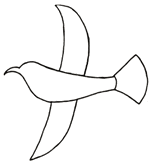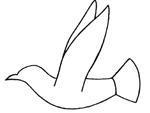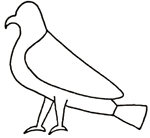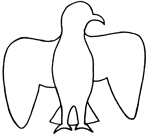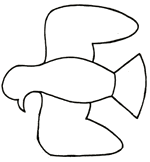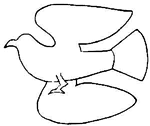Raubvögel in der frühgriechischen Kunst
Bildkonventionen in archaischer Zeit
Auszüge aus der Magisterarbeit 1988*
In den frühen Hochkulturen spielen Raubvögel eine wichtige
Rolle als
Attribut, Sinnbild oder Personifikation der obersten Gottheiten
und Herrscher
. Auch in der griechisch-römischen Antike wird Raubvögeln eine
besondere Bedeutung beigemessen. So ist der Adler dem Gottvater Zeus/Jupiter zugeordnet.
Die homerischen Epen erwähnen Raubvögel im Zusammenhang mit
wichtigen kriegerischen Ereignissen. In entscheidenden Momenten erscheinen
am Himmel Adler oder Habicht als Vorzeichen der Götter.
Bereits in der orientalischen Kunst ist das Thema des Raubvogels im
Kampf mit einer Schlange
geläufig. In Griechenland wird der fliegende
Raubvogel mit oder ohne Schlange seit dem 7. Jh. v. Chr. als Schildzeichen
verwendet. Auf frühgriechischen Bildern tritt er häufig auch
als Begleiter von berittenen Kriegern auf.
Eine wichtige Rolle spielt der Adler weiterhin in Darstellungen der
Prometheussage
. Die archaische Vasenkunst überliefert zwei charakteristische
Momente des Mythos. In Sparta steht die Bestrafung des Prometheus im
Fokus: Auf lakonischen Vasenbildern stürzt sich der Adler auf den
tragischen Helden herab mit dem Ziel, den Leib seines Opfers zu zerreißen.
In Attika wird diese brutale Szene des Mythos nicht dargestellt: Hier
konzentriert sich die bildende Kunst auf die Rettung des Prometheus
durch Herakles, der den Adler mit seinen Pfeilen töten wird.
In der griechischen Vasenkunst treten Raubvögel seit dem späten
8. Jh. v. Chr. auf und bilden schließlich im 7. und 6. Jh. v.
Chr. einen
unverzichtbaren Bestandteil der Ikonographie
. Sie sind in
allen relevanten Vasengattungen archaischer Zeit anzutreffen, in großer
Zahl vor allem auf korinthischen, lakonischen und attisch-schwarzfigurigen
Vasen. Sie finden sich auch auf Bronzeblechen, Münzen und Terrakottaplatten.
In den orientalischen und ägyptischen Frühkulturen
werden Darstellungskonventionen festgelegt, die über einen langen
Zeitraum beibehalten und selbst in der griechischen Kunst des 5. Jhs.
v. Chr. nur geringfügig verändert werden.
Raubvögel treten bereits auf mesopotamischen und ägyptischen
Kunstwerken des 4. Jts. v. Chr. auf. Vögel mit über dem Rücken
auseinandergespreizten Flügeln (Abb. 1) und Vögel, bei denen
der hintere Flügel vor der Brust geöffnet ist (Abb. 2), werden
bevorzugt in der neuassyrischen Reliefkunst dargestellt.

Abb.
1
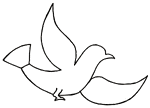
Abb.
2
Zur Seite fliegende Vögel mit rechtwinklig vom Körper abgespreizten
Flügeln (Abb. 3) oder mit erhobenen gestaffelten Flügeln (Abb.
4) sind offensichtlich ägyptische Schöpfungen. Meistens werden
Sing- und Wasservögel auf diese Weise wiedergegeben.
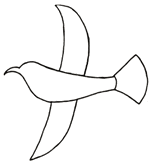
Abb.
3
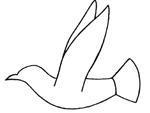
Abb.
4
Raubvögel wie Falken und Geier werden in Ägypten mit heruntergeklappten
Flügeln dargestellt. Diese
unnatürliche Flügelhaltung charakterisiert
ausschließlich göttliche Vögel
wie Horus und Nechbet.
Die strenge Stilisierung und der emblematische Charakter unterstreichen
ihre wichtige Rolle in der ägyptischen Religion.
Stehende Vögel im Profil finden sich schon früh in fast allen
Kulturkreisen (Abb. 5).
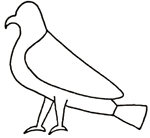
Abb.
5
Vom 4. bis 1. Jt. v. Chr. dominiert im Orient die
heraldische Darstellungsweise
:
frontaler Körper mit symmetrisch ausgebreiteten Flügeln und
zur Seite gewandtem Kopf (Abb. 6).
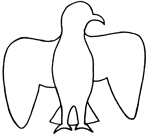
Abb.
6
Eine bedeutende Rolle spielt der
heraldische Adler
bei den Hethitern während
der Großreichszeit (1450 - 1200 v. Chr.).
Häufig treten
doppelköpfige Adler
auf. Ihre Bedeutung konnte
bisher nicht sicher geklärt werden.
Im ersten Drittel des 1. Jts. v. Chr. ist der heraldische Adler im Orient
nur noch selten anzutreffen. Dies hängt wohl mit seiner schwindenden
Bedeutung als Wappentier zusammen. In der orientalischen Elfenbeinkunst
des 8. Jhs. v. Chr. tritt der heraldische Adler nur sporadisch und in sehr
kleinem Format auf.
Erst im 5. Jh. v. Chr. kommt der Wappenadler bei den Skythen wieder zu neuen
Ehren.
Bei allen Darstellungen sind die charakteristischen Körperteile
(Kopf, Schwanz, Flügel und Fänge) so wiedergegeben, daß
sie auf einen Blick möglichst vollständig erfaßt werden
können. Jeder Körperteil ist durch eine begrenzende Konturlinie
deutlich vom Leib abgehoben.
Zur Seite fliegende Vögel mit am Handgelenk abgeknickten Flügeln
kommen in der orientalischen Kunst sehr selten vor. Bei diesen Darstellungen
wurde der oben besprochene heraldische Typus (Abb. 6) um 90 Grad gedreht.
Entweder liegen beide Beine symmetrisch an den Körperseiten an oder
sie werden ganz weggelassen (Abb. 7).
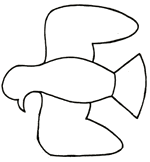
Abb.
7
In der griechischen Kunst bildet sich in der zweiten
Hälfte des 8. Jhs. v. Chr. eine
Formel für den fliegenden Raubvogel
heraus, die während der ganzen Archaik
von kanonischer Gültigkeit
bleibt (Abb. 8). Ihre wesentlichen Kennzeichen sind der im Profil dargestellte
Vogelkopf und die in die Fläche geklappten Flügel, die am Handgelenk
rechtwinklig abknicken.
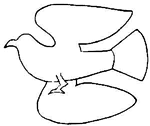
Abb.
8
Die Abhängigkeit von orientalischen Vorbildern (s. Abb. 7) ist evident.
Der horizontal ausgerichtete Kopf und die wie in der Sturzflugphase vorgewölbten
Flügel verleihen der Darstellung allerdings eine Dynamik, die die
orientalischen Beispiele vermissen lassen. Die gleitende Bewegung des
Fluges wird prägnanter zum Ausdruck gebracht.
Eines der frühesten Beispiele dieses Typus findet sich auf einem
protokorinthischen Aryballos der frühorientalisierenden Phase (vgl.
H. Payne, Protokorinthische Vasenmalerei, 1933, Taf. 6,1; spätes
8. oder erste Hälfte des 7. Jhs. v. Chr.). Bei dem in schwarzer Silhouette
gemalten Raubvogel läßt sich nicht entscheiden, ob die Flügel
von unten oder oben gesehen sind. Dasselbe gilt für den palmettenförmigen,
in Umrißzeichnung wiedergegebenen Schwanz. Die Klaue an der Unterseite
des Körpers läßt den Bauch als im Profil gezeichnet erscheinen
(Abb. 9). Offensichtlich gibt die Darstellung kein konkretes Flugbild
wieder, das einer Naturbeobachtung entspringt, stattdessen vereint sie
mehrere Ansichten des fliegenden Vogels
.
Es handelt sich um ein typisches Beispiel von
"Wechselansichtigkeit"
.
Auf diese Weise brachten "vorperspektivische" Künstler, die charakteristische
Eigenart und Fähigkeit einzelner Körperteile zum Ausdruck (vgl.
G. Krahmer, Figur und Raum in der ägyptischen und griechisch-archaischen
Kunst, 28. HallWPr, 1931, 19ff.; N. Himmelmann, Bemerkungen zur geometrischen
Plastik, 1964, 21; B. Kaeser, Zur Darstellungsweise der griechischen Flächenkunst,
1981).

Abb.
9
Seit dem zweiten Viertel des 7. Jhs. v. Chr. wird das Gefieder in Ritztechnik
angegeben. Wegweisend ist die Federzeichnung des Raubvogels auf einem
protokorinthischen Aryballos (Payne a.O. Taf. 20,1). Die Schwungfedern
sind durch horizontale Ritzungen angedeutet und von der Schulterpartie
durch zwei vertikale Linien abgesetzt. Ebenso ist der Palmettenschwanz
durch zwei parallele Linien vom Körper getrennt. Die Klaue ist bei
dem Schildzeichen nicht sichtbar (Abb. 10).

Abb.
10
Diese Darstellungsweise wird in der spätprotokorinthischen Vasenmalerei
beibehalten. Hinzu kommen Details wie der unterteilte Schnabel und eine
Trennlinie zwischen Körper und Kopf. In zunehmendem Maße werden
mittels Ritzungen und Farbauftrag auch Orbital, Nasenloch, Ohr und Klaue
sowie Schwung- und Schwanzfedern angegeben. Die untere Körperkontur
der Vögel ist immer durchgezogen, während die obere in der Regel
vom Flügel überschnitten wird. Der obere Flügel scheint
dadurch organisch aus dem Rumpf herauszuwachsen. Er wird als der vordere
Flügel empfunden, der sich dem Betrachter am nächsten befindet.
Der untere Flügel wirkt weiter entfernt. Auf diese Weise wird eine
Schrägansicht von unten
suggeriert.
Der von Korinth geprägte Typus des fliegenden Vogels breitet sich
im Laufe des 7. Jhs. v. Chr. in ganz Griechenland aus. In Athen erlebt er
seinen künstlerischen Höhepunkt in den monumentalen Adlern des
Nessos-Malers. Auf der sog. Nessosamphora stößt der Raubvogel
im steilen Flug hinab (Abb. 11; S. Papaspyridi-Karouzou, Aggeia tou Anagyrountos,
1963, Taf. 88). Eine hochgezogene Klaue ist sichtbar. Der Kopf des Adlers
ist aus ornamentalen Einzelformen zusammengesetzt. Zwei konzentrische
Kreise bilden das Auge. Das Ohr besteht aus einer kleinen Volute.
Auch
bei den Details wird das Prinzip der Wechselansichtigkeit deutlich.
Man
hat den Eindruck, daß der Vogel von unten gesehen wird. Dennoch
wurden in der mittleren Zone der Flügel die Decken angegeben, die
nur von oben sichtbar sind. Es war nicht die Absicht des Malers, ein möglichst
getreues Abbild der Natur wiederzugeben, sondern wesentlich erscheinende
Charakteristika des fliegenden Raubvogels in einer Darstellung zu vereinen.

Abb.
11
Bei einigen Varianten dieses Typus sind die Flügel auf dem Vogelleib
miteinander verbunden. Eine Lekanis des frühen 6. Jhs. zeigt einen
großen fliegenden Adler, der eine Schlange im Schnabel hält
(Abb. 12; MuM Basel 16, 1956, Taf. 17). Seine Bauchkontur ist nicht angegeben.
Die Schwingen treffen in der Mitte des Körpers fast zusammen, wie
dies nur bei einer Ansicht von oben möglich wäre. Es ist jedoch
eine Klaue eingezeichnet, die sich demnach fälschlicherweise auf
dem Rücken befände.

Abb.
12
Das 6. Jh. v. Chr. bringt bezüglich der Darstellung von fliegenden
Raubvögeln keine wesentlichen Neuerungen gegenüber dem 7. Jh.
In über 200 Jahren wird das Schema nicht grundsätzlich verändert.
An der althergebrachten Darstellungsweise, die weitgehend auf Verkürzungen
und Überschneidungen verzichtet, wird festgehalten. Verschiedene
Möglichkeiten der Gefiedermusterung werden erprobt, auch sind jetzt
häufiger beide Klauen des Vogels angegeben, die jetzt dicht nebeneinanderliegen.
Wichtiges Kennzeichen bleibt die spiegelsymmetrische Anlage der Flügel.
Erst im 5. Jh. v. Chr. sind perspektivische Verkürzungen
zu beobachten.
Der untere Flügel ist jetzt wie bei einer Ansicht
des Vogels von schräg unten nur zum Teil zu sehen. Die vom Körper
verdeckte Partie muß der Betrachter in seiner Phantasie ergänzen
(Abb. 13).

Abb.
13
Im frühen 6. Jh. v. Chr. bildet sich der Typus des Raubvogels mit parallel
hintereinandergelegten Flügeln heraus. Von dem hinteren Flügel
ist, wenn überhaupt, nur ein schmaler Streifen der Schulterpartie
sichtbar. Auch hier wachsen die Flügel rechtwinklig aus dem Körper
und knicken am Handgelenk nach hinten ab, so daß die langen Schwungfedern
parallel zum Körper verlaufen (Abb. 14). Die Vögel sind nicht
nur fliegend dargestellt, sondern auch ruhig stehend oder in dem Moment,
in dem sie gerade ihre Beute ergreifen.

Abb.
14
Dieser Typus findet sich erstmals in der korinthischen Vasenmalerei des
6. Jhs. v. Chr. Auf einem korinthischen Teller des frühen 6. Jhs. ist
ein fliegender Fischadler dargestellt, der in beiden Klauen und im Schnabel
kleine Delphine hält (Abb. 15; MuM Basel 1979, S. 64). Seine Beine
sind nicht angewinkelt, wie es sonst üblich ist, sondern steif durchgestreckt.
Die Flügel weisen die typische dreifache Unterteilung auf. Das Gefieder
ist bei beiden Flügeln identisch. Es wurde also
kein Unterschied
zwischen Außen- und Innenansicht
gemacht. Die mittlere Gefiederzone
des vorderen Flügels greift auf den Bauch über, wodurch eine
organische Verbundenheit suggeriert wird.

Abb.
15
Im 5. Jh. v. Chr. steigt die Popularität dieses Typus. Auf Münzen
und rotfigurigen Vasen verdrängt er allmählich die ältere
Formel (vgl. Abb. 8). Häufig wird der Adler des Zeus auf diese Weise
dargestellt. In der zweiten Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. findet eine
grundlegende Veränderung statt. Die Flügel sind nicht mehr streng
parallel gestaffelt, sondern X-förmig überkreuzt angeordnet.
Häufig überschneidet der hintere Flügel die Brustkontur.
Der Schwanz ist schmaler geworden und leicht nach unten geneigt (Abb.
16; P.R. Franke-M. Hirmer, Die griechische Münze, 1964, Taf. 63 Nr.
179).

Abb.
16
Es fällt auf, daß in der griechischen Kunst der klassischen
Zeit keine grundsätzlich neuen Typen entwickelt werden. Die kanonische
Darstellungsweise von Raubvögeln, die sich in der Archaik herausgebildet
hatte, wird grundsätzlich beibehalten.
Ausschlaggebend für diese
formelhafte, von sonstigen Entwicklungsprozessen kaum tangierte Darstellungsweise
ist die vorrangige Bedeutung der Raubvögel als Symbol und Emblem
im griechischen Kulturkreis.
Literatur
*Alexandra Kankeleit, Frühgriechische Raubvogeldarstellungen,
Magisterarbeit an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Bonn (1988) PDF 30 MB: ausführliche Anmerkungen und ein umfangreicher Abbildungsteil ergänzen den hier veröffentlichten
Text.
J. Börker-Klähn, Ein altorientalisches Motiv in Griechenland
und seine Rückwirkung auf den Iran, ZA 61, 1971, 124-156; N. Himmelmann,
Erzählung und Figur in der archaischen Kunst (1967); C. Krüger,
Der fliegende Vogel in der antiken Kunst bis zur klassischen Zeit (Dissertation
Quakenbrück, 1940); J. Pollard, Birds in Greek Life and Myth (1977);
M. Schmidt, Adler und Schlange, Boreas 6, 1983, 61ff.; R. Wittkower,
Allegorie und der Wandel der Symbole in Antike und Renaissance (1984)
45-56; zum Adler in der Heraldik der Neuzeit s. Artikel in
Wikipedia.